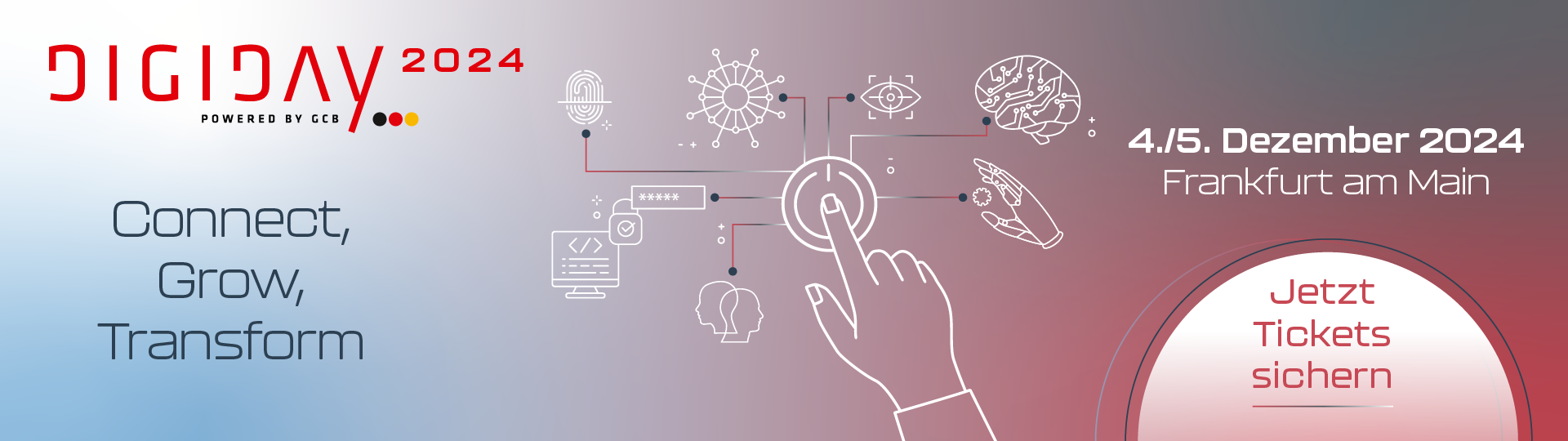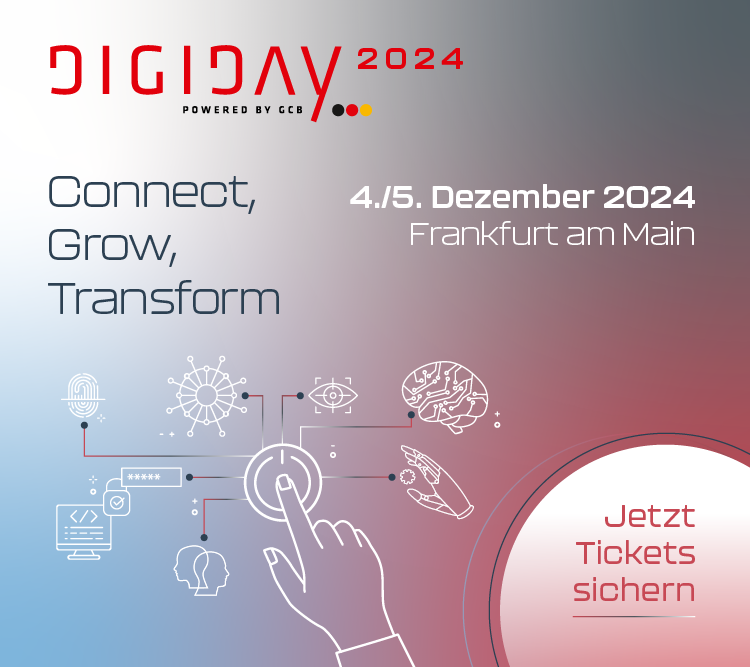Interview Tristan Horx
„Ich plädiere immer für den Zufall.“
Zukunftsforscher Tristan Horx am 04. September 2024 beim Meet Germany Summit Rhein-Main im Palais Frankfurt. In seiner Keynote „Transformation und GenZ“ warf er einen Blick auf die Zukunft der Digitalisierung, Mobilität, Globalisierung und Nachhaltigkeit. Foto: Meet Germany, Oliver Wachenfeld
Zukunftsforscher Tristan Horx am 04. September 2024 beim Meet Germany Summit Rhein-Main im Palais Frankfurt. In seiner Keynote „Transformation und GenZ“ warf er einen Blick auf die Zukunft der Digitalisierung, Mobilität, Globalisierung und Nachhaltigkeit. Foto: Meet Germany, Oliver Wachenfeld
Ein Gespräch unter Millennials: Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx über Generationen-Klischees, gegenseitiges Verständnis und gut geplante Zufälle in der Eventgestaltung.
tw tagungswirtschaft: Wie siehst du die Zukunft der Veranstaltungsbranche? Welche Entwicklungen sind nötig, um relevant zu bleiben?
Tristan Horx: Veranstaltungen werden sich stärker personalisieren müssen. In der Vergangenheit waren viele Events von einem regelrechten „Absitzungszwang“ geprägt. Viele Veranstaltungen sind im Laufe der Zeit immer größer geworden, oft ohne den Mehrwert für die Teilnehmenden zu steigern. Nach der Pandemie wurde das Ganze neu kalibriert – und man erkennt immer mehr, dass die wahre Magie zwischen den Gästen passiert, nicht beim Frontalvortrag eines Speakers. Wer nur den Vortrag hören möchte, kann das genauso gut auf YouTube tun. Veranstaltungen sollten daher Interaktionen zwischen den Menschen gezielt fördern.
Du erklärst die Gen Z in deiner Keynote zur „einsamsten Generation“. Wie beeinflusst das die Eventgestaltung?
Bei der jungen Generation merkt man die sozialen Defizite, die durch den Lockdown entstanden sind, besonders. Ich finde, man sollte da ein bisschen nachsichtig sein. Wenn man zwei Jahre lang eher weniger direkten Kontakt hatte und eigentlich erst lernt, wie Hierarchien und soziale Interaktionen funktionieren, hinterlässt das natürlich Spuren. Ich denke, da könnte die Veranstaltungsbranche noch lernen. Es ist aber extrem schwer, das „echte“ soziale Miteinander künstlich zu erschaffen. Speed-Dating-ähnliche Formate wirken oft aufgesetzt und unangenehm. Deswegen ist meiner Meinung nach der Zufall so wichtig, gerade im Hinblick auf die junge Generation. Dabei sollte die Formel sein, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, um die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen – und nicht das Event selbst zu digitalisieren.
Foto: Meet Germany, Oliver Wachenfeld
„Für eine resiliente, nachhaltige Eventbranche ist die Vielfalt der Generationen ein echter Schatz.“
Drei Fragen an Tanja Schramm, Geschäftsführerin bei Meet Germany, über die Bedeutung der Zukunft bei den Meet Germany Summits.
In aktuellen Diskussionen um Generationenkonflikte steht insbesondere die Gen Z im Mittelpunkt. Was macht diese so besonders, und gab es solche Debatten auch schon bei früheren Generationen?
Tatsächlich erleben wir jetzt eine Situation, in der die Generation Z viel Aufmerksamkeit bekommt – weil sie demografisch bedingt ein „knappes Gut“ sind und damit zu einem Wirtschaftsfaktor werden. Die typischen Klischees, die man heute über die „jungen, faulen und dummen“ Generationen hört, sind allerdings keineswegs neu. Schon in den 1950er-Jahren hat sich beispielsweise das Time Magazine ausführlich mit der damaligen jüngeren Generation befasst und deren Charakteristika analysiert. Über die Baby-Boomer hat man später gesagt, sie seien „verweichlicht und dumm“, weil sie nicht in den Krieg ziehen mussten. Die Generation X und auch unsere eigene Generation standen ebenfalls in der Kritik – uns hat man zum Beispiel vorgeworfen, nur „nach dem Sinn zu suchen“ und uns als „faule Nichtsnutze“ abgestempelt. Das wiederholt sich nun ähnlich mit der Generation Z.
Aber diese Diskussion scheint heute viel größer?
Früher ging es bei der Generationenanalyse vor allem um eine moralische, wertegetriebene Diskussion. Jetzt hat sie direkte wirtschaftliche Auswirkungen: Unternehmen spüren den Fachkräftemangel, und wenn das die Wirtschaft belastet, wird das Thema auch stärker von den Medien aufgegriffen. Dazu kommt, dass die Gen Z die erste ist, die komplett im digitalen Zeitalter aufgewachsen ist und sich durch soziale Medien und Plattformen zusammengeschlossen hat. Deshalb wird sie vielleicht auch eher als eine Art „homogene Masse“ wahrgenommen.

Von links: ChatGPT-Experte Michael Maus, Tanja Schramm, Geschäftsführerin Meet Germany, und Tristan Horx beim Meet Germany Summit Rhein-Main 2024. Foto: Meet Germany, Oliver Wachenfeld
In Gesprächen mit „Gen-Z-lern“ wirken die meisten allerdings davon ziemlich genervt, ebenso wie von den herrschenden Vorurteilen …
Ja, das kann ich bestätigen. Erst in den letzten beiden Tagen war ich als Dozent in Heidelberg bei Bachelor-Studierenden in ihren 20ern. Die sind wirklich davon genervt. Und ich habe es gerade auch in meinem Vortrag gezeigt: Junge Männer werden immer konservativer, während junge Frauen dagegen immer liberaler werden. Daran erkennt man schon, dass die Kategorisierung nach Alter heutzutage auch einfach kein sehr guter Indikator für Werte ist. Man könnte fast behaupten, dass jetzt das Postgenerationszeitalter beginnt. Es gibt 60-Jährige, die total jung geblieben sind, und gleichzeitig 25-Jährige, die eher wie Pensionäre wirken – sie wollen nur den Porsche, ein Haus und eine Familie. Das, was man vielleicht spießig nennen würde. Als wir jung waren – und wir sind ja immer noch jung (lacht) –, hieß es immer: „Sammle Momente, nicht Dinge.“ Besitzen war nicht so wichtig; stattdessen gab es bei uns postmaterielle Tendenzen, wir waren eher an Erlebnissen interessiert. Die junge Generation heute wächst dagegen in einer Zeit der Knappheit auf, und da gewinnen Status und Besitz wieder an Bedeutung – man sieht das unter anderem an der Rückkehr zur Designerkleidung. Das war bei uns nicht so verbreitet. Auch das macht die „Z-ler“ so interessant, weil sie diesen Gegentrend verkörpern.
Rekursionstheorie
Nach der sogenannten „Rekursionstheorie“ treibt die Dynamik von Trends und ihren Gegentrends den gesellschaftlichen Wandel entscheidend voran: In diesem Wechselspiel würden neue Synthesen entstehen, die Widersprüche aufheben und die Gesellschaft auf eine höhere Komplexitätsebene heben. Megatrends wie Globalisierung oder Individualisierung würden langfristige Entwicklungen formen, doch ebenso starke Gegentrends erzeugen, die auf Veränderung und Anpassung abzielen – etwa De-Globalisierung oder das Streben nach Gemeinschaft. Diese Dialektik verleihe Krisen eine transformative Funktion, indem sie etablierte Muster aufbricht und Raum für innovative, nachhaltige Lösungen schafft. So würden Fortschritt und Wandel als Ergebnis eines kontinuierlichen Balanceakts zwischen bestehenden Trends und ihrer Weiterentwicklung entstehen.
Du hast ja auch vom „Gender Value Gap“ gesprochen. Wenn es innerhalb der Generation Z diese gegenläufigen Trends gibt, warum wird sie dann aber in ihrer Gesamtheit als konservativer beschrieben? Reagieren also die jungen Frauen auf die Werte der jungen Männer?
Es gibt tatsächlich Unterschiede, die sich vor allem bei den Ansichten zu den Themen Geschlechterrollen oder Familienstrukturen manifestieren. Aber auch in den Bereichen wie Besitz und Eigentum, also eher bei den geschlechtsunabhängigen Werten, zeigen sich konservative Tendenzen – und hier trifft das auch auf viele junge Frauen zu. Genau das macht es auch schwieriger, Gen Z als eine einheitliche Generation zu betrachten. Eigentlich müsste man Gen-Z-Frauen und Gen-Z-Männer separat untersuchen. Dabei ist es interessanterweise so, dass sich die verschiedenen Geschlechter meistens gefallen wollen und miteinander agieren. Ein spannender, ganz aktueller Trend ist die sogenannte „Tradwife“-Bewegung auf TikTok. „Trad“ steht für „traditional“, und diese Bewegung zeigt Frauen, die das traditionelle Rollenbild bewusst annehmen, also zu Hause bleiben, sich dem Mann unterordnen, kochen, backen und sich in Blumenkleidern präsentieren. Das ist eine riesige Bewegung, und ob man es will oder nicht – man muss sich damit auseinandersetzen, wenn man diese Generation als Ganzes verstehen will.
Vertreter bestimmter deutscher Parteien sprechen auf TikTok ja auch gerne über das Bild „richtiger Männer“ …
Wenn man sich die Zahlen ansieht, wählen junge Männer tatsächlich vermehrt die AfD, und das hat auch mit diesen Vorstellungen zu tun. Die Partei spielt bewusst auf traditionelle Männlichkeitsbilder an. Es gibt diesen wahrgenommenen Druck auf Männer, dass sie „weiblicher“ werden sollen – also Gefühle zeigen, sensibler sein und so weiter. Viele junge Männer wollen da nicht mitmachen und neigen dazu, sich ins Gegenteil zu flüchten. Da kommt dann jemand und sagt: „Früher waren die Rollenbilder besser, gehen wir zurück in diese Zeit.“ Damit entwickeln viele eine Nostalgie für eine Zeit, die sie gar nicht kennen. Sie haben eine idealisierte Vorstellung davon, wie es früher gewesen sein soll. Und das scheint auszureichen – wohl auch, weil es kaum männliche Vorbilder gibt, die ein modernes, aber zugleich starkes Bild von Männlichkeit vermitteln. Stattdessen gibt es Figuren wie Andrew Tate, die toxische Männlichkeit verkörpern. Auf der anderen Seite fehlt es an Vorbildern, die diese „gefühlvolle“, „weiblichere“ Männlichkeit glaubhaft repräsentieren – an der perfekten Erklärung dafür arbeite ich aber noch.

Der lineare Zukunftsfehler sei einer der häufigsten Denkfehler bei der Betrachtung und Planung der Zukunft: Ein isoliert betrachteter Trend wird einfach aus der Vergangenheit in die Zukunft verlängert, ohne systematische Reaktionen, Anpassungen oder Veränderungen (Gegentrends) zu berücksichtigen. Foto: Meet Germany, Oliver Wachenfeld
In deinem Vortrag hast du erwähnt, dass der emotionale Tiefpunkt bei Menschen um die 35 Jahre liegt. In einer Epoche des beschleunigten Wandels – und angesichts der Tatsache, dass wir immer älter werden – könnte sich dieser Tiefpunkt möglicherweise nach hinten verschieben. Gerade wenn wir an die Generation Alpha denken, die voraussichtlich die höchste Lebenserwartung haben wird, stellt sich die Frage: Verändert sich damit auch die Dynamik im Lebenslauf?
Es ist spannend zu beobachten, wie sich die Lebensphasen verändern. Früher hatten wir drei klar abgegrenzte Phasen: die Ausbildungszeit, die Erwerbsphase und die Rente. Heute sieht das anders aus. Es gibt mehr solcher Phasen, die wir durchlaufen. Und jedes Mal, wenn wir eine neue Phase betreten, erleben wir eine Art Übergangskrise. Man kann es sich wie eine Treppe vorstellen, bei der jeder Schritt eine neue Herausforderung mit sich bringt, die uns in die nächste Phase „zwingt“. Daher könnte es sogar sein, dass die intensiveren Krisen, wie der besagte Tiefpunkt, eher früher erlebt werden als später. Das ist aber nur eine Prognose. Die erste große Lebenskrise ist für die meisten Menschen die Pubertät – das ist sozusagen der Klassiker. Danach folgt die Karrierezeit, mit der früher gleichzeitig eine Familie gegründet wurde. Heute hingegen ist es oft so, dass man erst einmal mehrere Jahre arbeitet, um überhaupt finanziell stabil genug für eine Familie zu sein. Und was dabei auffällt: Der „Pfeil“ des Wohlbefindens zeigt oft nach oben, wenn die Familiengründung beginnt. Eine Familie zu haben, macht viele Menschen glücklich.
Die U-Kurve des Lebens
Die U-Kurve des Lebens ist ein Konzept in der Glücksforschung, das die Zufriedenheit und das Wohlbefinden im Laufe des menschlichen Lebens beschreibt. Dieses Phänomen zeigt, dass die Lebenszufriedenheit typischerweise einer U-förmigen Kurve folgt: Sie beginnt relativ hoch in der Jugend, sinkt dann ab und erreicht ihren Tiefpunkt in den mittleren Jahren, bevor sie im späteren Leben wieder ansteigt. Die Gründe für diesen Verlauf sind vielfältig und können unter anderem mit sich verändernden Lebensumständen, Erwartungen und Prioritäten zusammenhängen.
Du sagst auch, dass wir „den Jahren immer mehr Leben“ geben. Damit ändert sich heute auch der Übergang ins Alter, oder? Und welche prägenden Ereignisse kommen dann in den Biografien noch hinzu?
Ein Beispiel ist die Häufigkeit von Lebensabschnittspartnern. Heute ist es wahrscheinlicher, dass Menschen mehrere langfristige Beziehungen haben, die dann enden und jeweils eine Art biografische Zäsur darstellen. So eine Trennung bringt oft große Veränderungen mit sich – viele ziehen danach um oder verändern ihr Leben grundlegend. Das traditionelle Modell, bei dem man mit 25 heiratet und bis zum Lebensende zusammenbleibt, ist eher die Ausnahme geworden. Heute hat man im Schnitt mindestens drei langjährige Beziehungen, und das beeinflusst die Biografie stark. Ich höre auch häufiger, dass Eltern, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, noch einmal in die Großstadt ziehen und das Leben genießen. Diese Phase gab es früher selten. Und dann kann es sein, dass man sogar in dieser Phase noch einen neuen Partner findet, was wieder zu einem neuen Lebensabschnitt führt. Man sieht also: Die Biografien haben heute generell mehr Phasen, die schneller aufeinander folgen.
Angesichts dieser immer schneller ablaufenden Entwicklungen: Wird damit nicht auch das intergenerationelle Unverständnis immer nur noch größer?
Absolut. Ein gutes Beispiel ist das Phänomen, dass die Generation Z plötzlich Harry Potter für sich entdeckt hat und unsere Generation, die Millennials, dann dafür belächelt hat, dass wir so an diesen Geschichten hängen. Und hier reden wir noch nicht einmal von einem Konflikt zwischen Baby-Boomern und Gen Z, sondern zwischen Generation Y und Z. In meiner Erinnerung war 9/11 unsere große Krise, die unsere Welt völlig verändert hat. Wir haben ja noch eine Phase erlebt, in der es uns gutging; wir haben noch das Ende des Millennium-Aufschwungs kurz vor der Dotcom-Blase wahrgenommen. Die Generation Z hat solche Krisen jetzt schon mehrfach miterlebt – die Finanzkrise, die Pandemie, Krieg in Europa. Und all das hat sie in der Aufmerksamkeitsökonomie erlebt, mit ihren Smartphones. Stell dir das vor: Mit 14 willst du dir eigentlich nur lustige TikTok-Tanzvideos anschauen und wirst plötzlich mit schwerwiegenden globalen Themen konfrontiert – da ist die Kindheit vorbei. Ich halte das schon für wirklich gefährlich. Da ist auch eine gewisse Ironie drin. Ich erforsche diese Themen selbst, und trotzdem merke ich, dass ich manchmal in die gleichen Klischees falle. Wenn ich denke, dass TikTok die Jüngeren „verdummen“ könnte, fühle ich mich dann doch etwas wie frühere Generationen, die über Fernsehen oder das Internet geschimpft haben. Vielleicht ist das aber auch einfach der Generationen-Neid, weil man weiß, dass man eines Tages bloß mehr ein Tourist in der Welt der Jüngeren sein wird. Ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass wir irgendwann Altersbeschränkungen für soziale Medien einführen, ähnlich wie für den Alkoholkonsum. Ein Modell, das ich mir vorstellen könnte, ist so eine Art „Kinderbett“ für Geräte: das wären speziell konfigurierte Smartphones oder Tablets, die in ein gesondertes Netzwerk eingebunden sind. Damit könnten Kinder und Jugendliche nur auf altersgerechte Inhalte zugreifen, ohne dass sich ungeeignete Apps oder Inhalte einschleichen. Es ist ein schwieriger Balanceakt, denn Kinder ohne Smartphones werden heutzutage oft zum Mobbingziel, wenn alle anderen eines haben.